Zivilgesellschaft in aufregenden Zeiten
Erste Erfahrungen mit der neuen Bundesregierung
Ein Fachbeitrag von Rupert Graf Strachwitz
Stiftungs-News März 2022 – Newsletter abonnieren
In einem im Januar 2022 vorgelegten Bericht konnten wir feststellen: „Die politik- und sozialsystemischen Rahmenbedingungen für die Zivilgesellschaft in Deutschland sind gut. Deutschland bietet mit seinem demokratischen, föderalen Regierungssystem und seiner politischen Kultur gute Voraussetzungen für eine aktive Zivilgesellschaft.“ (1) Diese Feststellung gründete sich nicht zuletzt auf die Erwartungen, die der Koalitionsvertrag der seit Dezember 2021 im Amt befindlichen Bundesregierung geweckt hatte. (2) Achtzehnmal wird der Begriff Zivilgesellschaft darin verwendet; auch der des bürgerschaftlichen Engagements, und: „Wir wollen eine Kultur des Respekts befördern – Respekt für andere Meinungen, für Gegenargumente und Streit, für andere Lebenswelten und Einstellungen.“ (3) „Dazu hat sich die neue Bundesregierung viel vorgenommen. Das Eintreten für Menschenrechte kommt mehrfach vor, etwas seltener auch für Bürgerrechte. Auch von Partizipation und Beteiligung ist mehrfach die Rede. Das liest sich gut!“ (4)
Trostpflaster
Nicht ganz so gut, aber (5) auch nicht ganz schlecht las sich das auch in früheren Koalitionsverträgen. Ganz gleich, wer mit wem den Vertrag schloss, von Reformen im Gemeinnützigkeitsrecht und Stiftungsrecht und von weniger Bürokratie war mindestens seit 1998 immer irgendwie die Rede. Was dann geschah, war mit einer Ausnahme immer gleich: Drei Jahre lang geschah gar nichts, und gegen Ende der Legislaturperiode wurde hastig irgendetwas auf den Weg gebracht. Die Ausnahme war die Einsetzung einer Enquete-Kommission des Bundestages im Jahr 1999; diese produzierte einen umfangreichen Abschlussbericht, von dem aber auch kaum etwas umgesetzt wurde. Ansonsten gab es jedes Mal ein paar Trostpflaster, die erkennen ließen, wie unwichtig der Politik das Thema in Wirklichkeit war. Auch 2021 war es nicht anders. Eine von der Verwaltung und für die Verwaltung konzipierte „Reform“ „des“ Stiftungsrechts brachte für die Stiftungen bürgerlichen Rechts (und nur für diese) ganz kurz vor dem Ende der Legislaturperiode einen neuen Rechtsrahmen, der zwar viermal so lang ist wie der alte, aber kaum den Geist eines Aufbruchs atmet. Das Stiftungsregister, das ohnehin erst 2026 in Kraft treten soll, ist zwar im Grundsatz sinnvoll, lässt aber in der Konzeption viele Wünsche offen. Ein wirkliches Interesse zeigte aus den politischen Parteien niemand dafür. Nur der Missbrauch der Rechtsform für die Gründung der Stiftung Klima- und Umweltschutz Mecklenburg-Vorpommern erregte ein wenig die Gemüter.
Neuer Elan
Die große Frage war also, ob dies mit der neuen Bundesregierung und auf der Grundlage eines neuen Vertrags anders werden würde. Wie nie zuvor hatten Think Tanks und Verbände der Zivilgesellschaft im Vorfeld der Bundestagswahl Forderungen erhoben und Vorschläge gemacht (6); zur Verwunderung der Parteien richteten sie sich nicht oder nur nebenbei auf steuerliche Erleichterungen oder überhaupt auf finanzielle Probleme. Der Zivilgesellschaft ging es, so war als Tenor herauszulesen, ging und geht es um eine aktive deliberative Demokratie jenseits der Parteien und um die Weiterentwicklung der Demokratie. Dazu schien der am 6. Dezember 2021 abgeschlossene Koalitionsvertrag tatsächlich etwas zu sagen; neuer Wind schien tatsächlich durch die Ministerien zu wehen. Bei Gesprächen war zu hören, man sei jetzt gehalten, „mehr mit der Zivilgesellschaft zu machen“. Ein neuer Anwendungserlass zur Abgabenordnung räumte alsbald weitgehend mit dem Ärgernis des Verbots der politischen Betätigung von steuerbegünstigten Organisationen auf.
Und schon stockt es wieder
Aber schon beim Gestalten der parlamentarischen Arbeit stockte der Elan. Von vielen Seiten war gefordert worden, erstmals einen Bundestagsausschuss für bürgerschaftliches Engagement einzurichten. Leider wurde es wieder nur ein Unterausschuss. Und dem Wunsch, ihn im Hinblick auf das im Vertrag für 2023 angekündigte Demokratiefördergesetz (das in der letzten Legislaturperiode am Widerstand der CDU/CSU gescheitert war) wenigstens als ‚Unterausschuss für bürgerschaftliches Engagement und Demokratieförderung‘ zu bezeichnen, mochten sich die Abgeordneten schlussendlich auch nicht anschließen, nachdem zwei Ministerien Bedenken geäußert hatten.
Zu dem Demokratiefördergesetz gibt es inzwischen ein Diskussionspapier aus dem Innen- und dem Familienministerium, die dementsprechend wohl auch gemeinsam den Gesetzentwurf vorlegen werden. Man kann nur hoffen, dass dieser über das Diskussionspapier, das ganz offenkundig wieder aus der Schublade geholt wurde und entsprechend abgestanden anmutet, einen großen Schritt hinausgeht. Tut er es nicht, bekommen wir ein Gesetz, das mit konventionellen, verwaltungsorientierten Maßnahmen und kaum vorhandenen Haushaltsmitteln einer fundamentalen Vertrauenskrise Herr zu werden und eine grundlegend veränderte Öffentlichkeit „in den Griff“ zu bekommen sucht. Vom Geist des Koalitionsvertrags spürt man bei der Lektüre wenig; für eine konstruktive Weiterentwicklung und Reform der gegenwärtigen Demokratie ist das Diskussionspapier nicht konzipiert; ebenso wenig ist es von dem Gedanken getragen, andere angekündigte Gesetzgebungsvorhaben, beispielsweise die dringend anstehende grundlegende Revision des steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts, bewusst unter das Vorzeichen der Demokratieförderung zu stellen. Ob dies anders sein wird, wenn dieses Vorhaben umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Auf der Arbeitsebene im Bundesfinanzministerium wird daran gearbeitet, aber noch ist nicht klar, ob es sich die politische Spitze des Hauses wirklich zum Thema machen wird, den steuerrechtlichen Rahmen der Zivilgesellschaft aus dem frühen 20. in unser 21. Jahrhundert zu befördern, das sich hinsichtlich des Gesellschaftsmodells und der Lebenswelt der Bürgerinnen und Bürger so offenkundig beträchtlich von dem damaligen unterscheidet. Bisher jedenfalls hat sich auch noch kein Minister tatsächlich für den angepriesenen Dialog mit der Zivilgesellschaft geöffnet. Dabei geht es um mehr als um Steuern, Aufsicht, Kontrollen und Regulierung!
Rolle der Zivilgesellschaft
Gewiss, es gab weiterhin Corona, und es gab den russischen Angriff auf die Ukraine. Jedem leuchtet ein, dass gerade dieser mit der dadurch ausgelösten großen Wende der jahrzehntealten deutschen Sicherheitspolitik alle Kräfte bindet. Aber in keiner vergleichbaren Auseinandersetzung hat je die Zivilgesellschaft eine so wichtige Rolle gespielt. Ralf Dahrendorfs altes Diktum von der Außenpolitik der Gesellschaften, die die Außenpolitik der Staaten abzulösen habe, hat sich in diesem Krieg als beängstigend richtig erwiesen. Krieg wird nicht mehr nur von Armeen geführt, von Kombattanten, die von den Staaten eingesetzt werden; Bürgerinnen und Bürger in großer Zahl haben daran teil – bis hin zu den schon vor längerer Zeit außerhalb Europas beschriebenen armed non-state actors, also zivilgesellschaftlichen Gruppen, die bewaffnet in die Auseinandersetzung eingreifen. Damit stürzt eine zentrale normative Maxime zivilgesellschaftlichen Handelns: der Verzicht auf Gewalt. Wer Gewalt anwandte, gehörte auf Europa bezogen noch vor wenigen Wochen zur dunklen Seite der Zivilgesellschaft. Jetzt verschiebt sich diese Grenze auf dramatische Weise. Wo die neue Grenze liegt, ist schwer vorauszusagen, sie gehört intensiv diskutiert; der in der Corona-Krise von Politik und Verwaltung praktizierte Neo-Etatismus war jedenfalls keine gute Vorbereitung für eine Neujustierung des Verhältnisses zwischen Staat und Zivilgesellschaft.
Mindset ändern!
Die Aussage im Koalitionsvertrag, der Staat nähme nach dem Willen der neuen Bundesregierung den bürgerschaftlichen Raum ernsthaft in den Blick und bekenne sich mit einer eindeutigen Formulierung zu einer Koalition aller Demokraten im Kampf gegen die Gegner von Demokratie und Herrschaft des Rechts (7), hat jedenfalls eine völlig neue Dimension gewonnen. Noch aber schimmert an vielen Stellen ein Verständnis durch, das die Zivilgesellschaft wie ehedem nur in der Rolle von Antragstellern und Herrschaftsobjekten, nicht aber als Partner im politischen Dialog sieht. Diesen Mindset zu ändern, war im Vorfeld der Bundestagswahl die zentrale Forderung vieler engagierter Bürgerinnen und Bürger. Seit dem 24. Februar gilt dies erst recht. Zivilgesellschaft ist eine starke Kraft, sie trägt wesentliches zum Gelingen eines politischen Arrangements bei, sie gestaltet Politik mit. Mit ihr die Demokratie zu verteidigen, aber auch ihre Akteure zu schützen und vor allem unablässig mit diesen im Dialog zu sein, ist wichtiger denn je. In der Vergangenheit hat dies manchmal funktioniert; in der Corona-Krise hat es nicht funktioniert. Angesichts der Entwicklungen, die Herr Putin losgetreten hat, muss es wieder funktionieren. Trostpflaster darf es da keine mehr geben.
Fußnoten
(1) Siri Hummel, Laura Pfirter und Rupert Graf Strachwitz: Zur Lage und den Rahmenbedingungen der Zivilgesellschaft in Deutschland – Ein Bericht. Berlin: Maecenata 2022 (Opusculum Nr. 159) https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/76997
(2) SPD / Bündnis 90-Die Grünen / FDP (Hrsg.): Mehr Fortschritt wagen – Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Koalitionsvertrag 2021-2025. https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
(3) a.a.O., S. 7
(4) Rupert Graf Strachwitz: Was hat die neue Bundesregierung mit der Zivilgesellschaft vor? Zum Koaliti-onsvertrag zwischen SPD, Grünen und FDP . Berlin: Maecenata 2021 (Observatorium Nr. 58) https://www.maecenata.eu/2021/12/13/was-hat-die-neue-bundesregierung-mit-der-zivilgesellschaft-vor/
(5) siehe u. a.: Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (Hrsg.): Zivilgesellschaft und Bundestagswahl 2021. Berlin: BBE 2021 (Dossier Nr. 9) https://www.b-b-e.de/fileadmin/Redaktion/06_Service/02_Publikationen/2021/2021-bbe-reihe-dossier-9.pdf
(6) Strachwitz, a.a.O.
Foto: Jürgen Fächle, stock.adobe.com
Autor dieses Fachbeitrags
Dr. phil. Rupert Graf Strachwitz ist Politikwissenschaftler und Historiker. Er ist Vorstand der Maecenata Stiftung, München, eines unabhängigen Think Tank, und Direktor des zur Stiftung gehörenden Maecenata Instituts für Philanthropie und Zivilgesellschaft, Berlin, einer außeruniversitären Forschungseinrichtung.
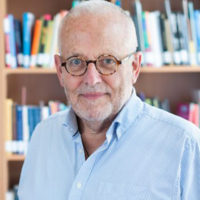
Viel mehr lesen
Praxistipps und Fachbeiträge rund ums Stiften, Spenden und Fördern – für alle, die sich gemeinnützig engagieren.